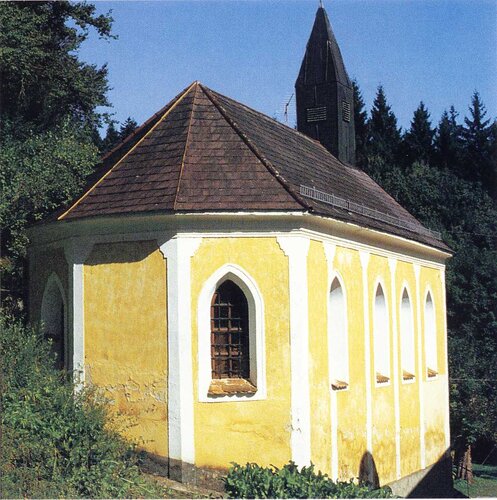Kapelle in Kneiding
Stammdaten
Permalink:
Kategorie:
Einfache Kapelle
Zustand:
Sehr gut / Renoviert
Denkmalstatus:
steht unter Denkmalschutz
Ort (Bezirk):
4784 Schardenberg (Schärding)
Adressbeschreibung:
Schönbachkapelle in Kneiding (Auerkapelle)
Adresse (Ortschaft):
Schönbach Kneiding (Schönbach)
Breiten-, Längengrad:
48.517501512613, 13.543216061746 (Navigation
starten)
Symbol
Kreuz: Kleeblattkreuz
Im Zentrum des Antependiums appliziert hellgelb und goldfarben umrahmt.
Gedenktafel
Material für Tafeln
Stein
Mauer, auf Putz gemalt und mit Stuckrahmen versehen.
Inschriftentyp
Einfache Inschrift
Geschichte der Kapelle an der rechten Seitenwand.
Kapellenausstattung
Altar
Außergewöhnlicher Hochaltar von 1862/65; ein die gesamte Raumbreite einnehmender, treppenartig zur Mitte hin ansteigender Aufbau mit bemerkenswerten gotisierenden Figuren. Apostel und Salvator mundi auf den Stufensockeln, neogotisches Schnitzdekor. Auf der Mensa breiter Rechteckaufsatz
Sakrale Figur
Material für Figuren
Gips
Sakrale Ikonographie
Christusdarstellung - Segnender Jesus
Darstellung des Salvator Mundi auf der höchsten Stufe des Altares flankiert von den Aposteln auf den Stufen.
Sakrale Figur
Material für Figuren
Ton/Keramik
Sakrale Ikonographie
Mariendarstellung - Maria mit Kind
Thronende Madonna mit Kind und Lamm, 2.H 19. Jh.
Sakrales Bild
Material für Bilder
Karton/Papier
Sakrale Ikonographie
Mariendarstellung - Herz Mariä
Im Altaraufbau links.
Sakrales Bild
Material für Bilder
Karton/Papier
Sakrale Ikonographie
Christusdarstellung - Herz Jesu
Im Altaraufbau rechts.
Kapellenausstattung
Tabernakel
Auf der Mensa dem Altaraufbau integriert mit Nische.
Kreuz
Kreuzform
Lateinisches Kreuz (mit Kugelenden)
Kreuzdarstellung
Kruzifix mit Assistenzfiguren
Das Kruzifix mit der Assistenzfigur Maria steht in der Rundbogennische des Tabernakels.
Sakrale Figur
Material für Figuren
Ton/Keramik
Sakrale Ikonographie
Mariendarstellung - Herz Mariä
Links neben dem Kruzifix in der Rundbogennische des Tabernakels.
Sakrale Figur
Material für Figuren
Ton/Keramik
Sakrale Ikonographie
Christusdarstellung - Herz Jesu
Rechts neben dem Kruzifix in der Rundbogennische des Tabernakels.
Sakrale Figur
Material für Figuren
Ton/Keramik
Sakrale Ikonographie
Mariendarstellung - Fatimamadonna
Auf dem Tabernakel
Sakrale Figur
Material für Figuren
Gips
Sakrale Ikonographie
Engel
Die Fatimamadonna flankierend.
Kapellenausstattung
Kanontafeln
Drei Kanontafeln mit Holzrahmen stehen in der auf der Mensa.
Sakrale Figur
Material für Figuren
Gips
Sakrale Ikonographie
Heiligendarstellung - Hl. Sebastian
Am Boden neben dem Altar rechts.
Kapellenausstattung
Standkerzenhalter
4 silberne, ziselierte Kerzenhalter stehen auf der Mensa.
Sakrale Figur
Material für Figuren
Gips
Sakrale Ikonographie
Christusdarstellung - Segnender Jesus
Links auf einer Konsole an der Seitenwand im unmittelbaren Anschluss an die Altartreppen
Sakrale Figur
Material für Figuren
Gips
Sakrale Ikonographie
Heiligendarstellung - Hl. Katharina von Alexandrien
Rechts auf einer Konsole an der Seitenwand im unmittelbaren Anschluss an die Altartreppen
Sakrale Figur
Material für Figuren
Gips
Sakrale Ikonographie
Heiligendarstellung - Hl. Leonhard
In einer Rundbogennische
Sakrale Figur
Material für Figuren
Gips
Sakrale Ikonographie
Heiligendarstellung - Hl. Josef mit Jesuskind
Auf links über Eck gehängter Mensa, Anfang 20.Jh.
Sakrale Figur
Material für Figuren
Gips
Sakrale Ikonographie
Mariendarstellung - Maria Immaculata
Rechts , Anfang 20.Jh.
Sakrale Figur
Material für Figuren
Holz
Sakrale Ikonographie
Heiligendarstellung - Anna Selbdritt
3.Drittel 19.Jh. gotisch adaptiert.
Sakrale Figur
Material für Figuren
Gips
Sakrale Ikonographie
Heiligendarstellung - Hl. Martin
Rechte Seitenwand auf einer Konsole.
Sakrale Figur
Material für Figuren
Gips
Sakrale Ikonographie
Heiligendarstellung - Hl. Margareta von Antiochien
Auf einer Konsole rechts.
Sakrale Figur
Material für Figuren
Holz
Sakrale Ikonographie
Engel
Schutzengel
Kreuzweg
Stationsanzahl
14 Stationen
Kreuzwegreliefs in den Wandnischen um 1862/65.
Kapellenausstattung
Sitzbank
Bankreichen für 50 Personen
Kapellenausstattung
Ewiges Licht
Kapellenausstattung
Weihwasserkessel
Beim Eingang rechts aus Stein.
Kapellenausstattung
Tabernakel
In den Altaraufbau integriert.
Architektonische Besonderheit
Glockentürmchen / Dachreiter
Mit Holz verkleidet, das Faltdach ist mit Biberschwanzziegeln gedeckt.
Fenster
Fensterform
Rechteckige Fenster mit geraden Sturz
Fensterfunktion
Schallfenster
4 Schallfenster im Dachreiter
Kreuz
Kreuzform
Lateinisches Kreuz (mit geraden Enden)
Kreuzdarstellung
Kreuz ohne Figur
Auf dem Dachreiter sitzt ein einfaches Kreuz.
Fenster
Fensterform
Eselsrücken / Tudorbogen (Spitzbogen)
Spitzbogenfenster
Fensterfunktion
Belichtung
10 Sprossenfenster mit gelben Glas, eingefasst mit grauen, profilierten Putzfaschen. Je 4 an den Seitenwänden 4 um die Apsis.
Tür
Türsturz
Bogenförmiger Sturz
Spitzbogen
Türblatt
Holztür - Eingestemmte Füllungstür
Neugotisch
Mauerwerk
Mauerwerk-Art
Granitstein
Mauerwerk-Technik
verputzt mit Steinbloßtechnik
Fassade seit der Restaurierung 2003/04 steinsichtig (ehem. Silhouettenpilastergliedererung).
Errichtung
1862
- 1865
Votationsgrund
Gelübde
Am 5. September 1862, das Jahr der Grundsteinlegung des Mariä-Empfängnis-Domes in Linz, begannen die Hammerschmiedleute Martin und Juliane Auer mit dem Bau eine der größten Kapellen im westlichen Oberösterreich. Die Einweihung erfolgte am 22. 8. 1865, eine Messlizenz wurde 1881 erteilt. Die "Schönbach-Kapelle", die eigentlich den Charakter einer Filialkirche besitzt, tritt nach außen hin in summa mit neugotischem Charakter in Erscheinung. Als bedeutendes Zeichen der Volksfrömmigkeit im unteren Innviertel stellt die Kapelle ein erhaltenswertes Kulturgut dar. Die Größenordnung des Baues und der Zusammenhang mit einem ehemaligen Hammerschmiede-Ensemble weisen dem Kapellenbau eine Sonderstellung in der Landschaft der Kapellen und übrigen Denkmäler der Volksfrömmigkeit zu. Im Jahre 2002 kam sie durch eine Stiftung im Besitz des Kulturvereines Kneiding, der sie in einer mehr als drei Jahre dauernden Generalsanierung wieder zu einem Schmuckstück gemacht hat. Die neugotische Kapelle wurde in liebevoller Kleinarbeit restauriert und neu gestaltet. Im Innenraum des heute noch als Tauf- und Hochzeitskirche gefragten Gebäudes befinden sich viele interessante Figuren und Gedenktafeln. Die Marienkapelle, sog. Auer-Kapelle für die Hammerschmiedleute Martin und Juliana Auer; restauriert 1954, 1981, 2003/04. Sie ist ein bemerkenswertes frühes Beispiel einer Kapelle des kirchlichen Historismus, in einer für diese Zeit kaum belegten volkstümlichen Übertragung. Der 3jochige, gesüdete Saalbau mit Polygonalschluss, eine letztlich aus dem Barock stammende Grundstruktur mit zitatartigen gotischen Formen sowie bemerkenswerter Ausstattung und Einrichtung. Über der Apsis abgewalmtes Satteldach, mit Dachreiter über quadratischem Grundriss. An der Giebelfront im N parallel zum Bau geführte Treppe zu spitzbogigem Mittelportal. Innen Stichkappentonnengewölbe mit Gurtbögen auf breiten Konsolen(wohl Holzgewölbe); an den längsfronten und neben dem Eingang aneinander gereihte spitzbogige Wandnischen in profilierter Stuckrahmung; leicht eingeschnürter korbbogiger Triumphbogen; im N-Joch Holzempore mit geometrisch bemalten Brüstungsfeldern. Der Chor mit stuckrippenunterlegtem Stichkappenkranz auf Kegelförmigen Konsolen. Gedrungene Brüstungsorgel 2. H. 19. Jh. unter Verwendung älterer Teile; 3feldriges neogotisches Gehäuse mit Außentürmen 4Reg., Pedal angehängt. Die Glocken wurden gegossen von Johann -Dettenrieder (Glockengießerei St Florian) 1929.
Literaturquelle
1996
Flur-und Kleindenkmäler in der Pfarre und Gemeinde Schardenberg,
Matthias Huber, Seite 71
Matthias Huber, Seite 71
Datenbankerfassung
2020-02
Huber Matthias
Letzte Überarbeitung
2024-10
KD Administrator
© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich