Luftensteiner Kapelle
Stammdaten
Permalink:
Kategorie:
Einfache Kapelle
Zustand:
Abgekommen - Gebrauchsspuren noch vorhanden
Ort (Bezirk):
4342 Baumgartenberg (Perg)
Adresse (Ortschaft):
Kolbing 16 (Kolbing)
Breiten-, Längengrad:
48.22475, 14.73861 (Navigation
starten)
a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):
460 cm
b) Gesamtbreite:
292 cm
c) Gesamttiefe:
355 cm
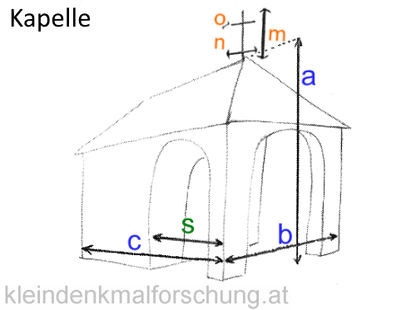
Kapellenfunktion
Haus- / Burg- / Schlosskapelle
Keine besondere Funktion mehr.
Fenster
Fensterform
Eselsrücken / Tudorbogen (Spitzbogen)
2 Stück links und rechts an den Seitenwänden; 106x38
Fensterfunktion
Belichtung
Strukturglas
Tür
Türsturz
Bogenförmiger Sturz
Spitzbogen als Archivolte gestaltet.
Türblatt
Holztür - Eingestemmte Füllungstür
Stark verwittert; 99x254
In der oberen Türhälfte ist eine Teilverglasung
Kapellenausstattung
Sitzbank
2 Stück, links und rechts an der Seite; 236x25
Kapellenausstattung
Ewiges Licht
Hänge-Ampel von der Decke; Metall; h=118
Kapellenausstattung
Weihwasserkessel
Marmor, 20x20x15
Kapellenausstattung
Standkerzenhalter
2 Stück, Glas; d=8; h=4
Kapellenausstattung
Kniebank
Holz; h=90, b=85
Sakrales Bild
Material für Bilder
Karton/Papier
Verglast mit Rahmen; 32x42
Sakrale Ikonographie
Christusdarstellung - Herz Jesu
Sakrales Bild
Material für Bilder
Karton/Papier
Verglast mit Rahmen; 32x42
Sakrale Ikonographie
Mariendarstellung - Herz Mariä
Verglast mit Rahmen; 32x42
Sakrales Bild
Material für Bilder
Karton/Papier
Verglast mit Rahmen; 32x42
Sakrale Ikonographie
Heiligendarstellung - Hl. Theresia vom Kinde Jesu
Sakrale Figur
Sakrale Ikonographie
Engel
teilweise bemalt
Material für Figuren
Gips
knieend, h=14
Sakrale Figur
Sakrale Ikonographie
Engel
2 Stück gleicher Bauart; h=24
Gipsguss unbemalt
Material für Figuren
Gips
knieend
Sakrale Figur
Sakrale Ikonographie
Mariendarstellung - Maria mit Kind
bemalt
Material für Figuren
Gips
Madonna; h=47
Sakrale Figur
Sakrale Ikonographie
Christusdarstellung - Herz Jesu
bemalt
Material für Figuren
Gips
h=26
Sakrale Figur
Sakrale Ikonographie
Heiligendarstellung - Hl. Theresia vom Kinde Jesu
bemalt
Material für Figuren
Gips
h=38
Mauerwerk
Mauerwerk-Art
Lehmziegel - gebrannt (Ton)
Mauerwerk-Technik
verputzt
weiß gestrichen, der leicht vorspringende Sockel ist dunkelgrau. Das Giebelfeld wird von einem Zahnfries umgrenzt. Beiderseits vom Eingang zieren Pilaster mit abgerundeten Kanten, vertieftem Innenfeld und korinthischem Kapitell die Vorderfront der Kapelle. Die Türlaibung ist als Archivolte gestaltet.
Im Innenraum ist der Altarbereich in drei Spitzbogennischen geteilt. Ein Schmiedeeisengitter mit Rautenmuster verschließt die größere mittlere Nische.
Den Abschluss bildet ein ziegelgedecktes Satteldach.
Errichtung
1700
- 1750
Votationsgrund
Pest/Seuche
Die Kapelle stand ursprünglich an der alten Straße nach Kolbing.
Die Kapelle ist von der Architektur her sehr aufwändig gebaut. Man betritt sie von Norden durch eine massive Holztür, welche von einem Spitzbogenportal mit erhabenen Gesimsen eingerahmt ist. Gleich darüber umläuft einZahnfries die gesamte Kapelle. Der Dreiecksgiebel an der Eingangsseite wird ebenfalls von dem Fries gleicher Bauart eingerahmt. An den Ecken der Außenwände befinden sich gemauerte Lisenen, die mit Stuckverzierungen abgeschlossen sind.
Im Inneren laden seitlich Bänke zum Verweilen ein. Das Deckengewölbe mit hervorgehobenen Rippenbögen schließt mit einem viereckigen Schlussstein ab. Links neben der Tür ist ein steinerner Weihwasserkessel angebracht. Licht kommt durch zwei Spitzbogenfenster an den Seitenwänden. An der Frontseite ist die mittlere große Altarnische durch ein schmiedeeisernes Gitter abgeschlossen. Dahinter befinden sich mehrere Statuen, eine Madonna mit Kind, flankiert von zwei knieenden Engeln; weiters eine Herz Jesus Figur und eine Statue von der hl. Therese von Lisieux vom Kinde Jesu. Heiligenbilder ergänzen die Innenausstattung. Zwei kleinere Nischen begrenzen seitlich die Hauptnische im Zentrum der Kapelle.
Geschichte(n):
Die sehr geräumige und begehbare Kapelle ist nach Norden zur nicht mehr existierenden ehemaligen Straße ausgerichtet. Das erklärt auch das abgesenkte Niveau im Vergleich zur heutigen Kolbinger Straße.
Über die Ursache der Entstehung gibt es unterschiedliche mündliche Überlieferungen. Eine Variante besagt, dass unter der Kapelle Pestopfer der Kolbinger Bevölkerung begraben seien und dass die Kapelle aus Dankbarkeit für die überstandene Pestepidemie errichtet worden sei. Eine andere Überlieferung erzählt von dem Maurermeister Anton Tremesberger, der die Kapelle gebaut haben soll, weil er vom Typhus verschont geblieben war. Dieser Erbauer soll im ehemaligen „Brunner“- Haus in Kolbing Nr. 1 gewohnt haben.
Restaurierungen geschahen in den letzten Jahren immer wieder, teils von den Besitzern oder von freiwilligen Helfern bzw. Organisationen.
Über das Alter der Kapelle gibt es keine Aufzeichnungen und auch keine Erinnerungen. Sollten tatsächlich in früherer Zeit unter der Kapelle Pestopfer beerdigt worden sein, kann man davon ausgehen, dass die Kapelle einige hundert Jahre alt ist. Um die Jahrhundertwende vom 17. auf das 18. Jahrhundert gab es in Oberösterreich um 1679, 1694/95 und zuletzt im Jahre 1713 die letzten größeren Pestepidemien. Nicht nur in den großen Städten, sondern auch in ländlichen Regionen waren viele Tote zu beklagen.
[1] Vgl. Pfarrmatriken Baumgartenberg, Ahnenforschung Tremesberger
Literaturquelle
2024
Stille Zeugen der Zeit. Klein-, Flur- und Naturdenkmäler in Baumgartenberg,
Ambros Kastler, Hans Tremesberger, Seite 117
Ambros Kastler, Hans Tremesberger, Seite 117
Datenbankerfassung
2025-04
Kastler Ambros
Letzte Überarbeitung
2025-07
Heilingbrunner Brigitte
© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich


