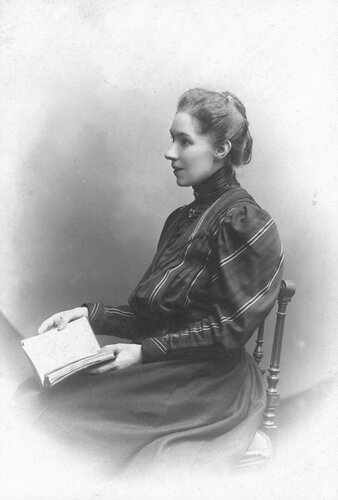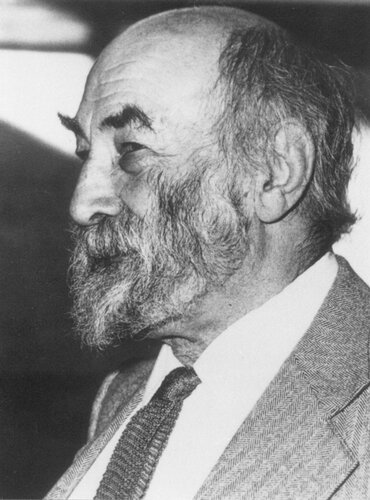Tendenzen der Nachkriegsliteratur in Oberösterreich
Auch in der oberösterreichischen Literatur erfolgte nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches kein Neubeginn – eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte war selbst nach Jahren kaum möglich. Neu- und Wiederauflagen von Werken bekannter Autoren aus der Zeit von Ständestaat und Nationalsozialismus zeugen von der Fortführung alter inhaltlicher, formaler und ideologischer Kontinuitäten, was zum einen auf die prekäre wirtschaftliche Situation der Autoren, zum andern auf das fehlende Bewusstsein über ideologische Zusammenhänge zurückzuführen ist. Das rigide Festhalten an alten Traditionen durch Autoren und Leserschaft ermöglichte jüngeren Generationen erst mit einiger Verzögerung eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Heute erlaubt diese in den 1950er Jahren einsetzende Thematisierung von Kriegserleben, politischer Repression und gesellschaftlichem Wandel im Nachkriegsösterreich einen Blick auf die Alltage der 1950er Jahre, in denen die Menschen mit der neu gewonnener Freiheit und Freizeit erst umgehen lernen mussten.
Ältere Generation – Traditionalisten
Es handelt sich dabei um die nach 1945 in Oberösterreich aktive Autorenschaft, die schon vor dem Krieg in der Literaturszene etabliert war und die mit dem Zusammenbruch der Monarchie ihre Prägung erhalten hatte. Zu dieser Generation sind das ästhetisierende Literatentum mit Julius Zerzer und Arthur Fischer Colbrie, sozialdemokratische Strömungen (Hedda Wagner, Otto Stöber) und katholische Literaturtraditionen (Enrica von Handel-Mazzetti) ebenso zu zählen wie Gesellschafts- und Unterhaltungsromane (Maria von Peteani und Hedda Wagner) und die insbesondere in Oberösterreich ausgeprägte Heimat- und Bauernliteratur mit mit einer großen Bandbreite zwischen künstlerischem Anspruch und zeitgeistiger Tendenzliteratur, vertreten durch Richard Billinger auf der einen – und Carl Hans Watzinger, Josef Günter Lettenmair, Maximilian Narbeshuber, Linus Kefer auf der anderen Seite.
Die Ideologisierung der Heimatliteratur war bereits um 1900 im Zuge der gegen Literatur und Literaturbetrieb in den Großstädten polemisierende „Heimatkunstbewegung“ erfolgt. Diese Stadt und Land polarisierende, das Bauerntum und die dörfliche Idylle idealisierende Literatur kam der Ideologie der Nazis entgegen und entsprach auch nach dem Krieg mit ihrem Angebot an altem Vertrauten den Lesebedürfnissen der Bevölkerung. – In den 1950er und 190er Jahren wichen viele dieser in alten Traditionen verhafteten Autoren in die Sachschriftstellerei aus.
Jüngere Generation – Paradigmenwechsel
Diese Generation, die in den 30er Jahren zu schreiben begann, hatte nach 1945 entweder das Engagement für das Naziregime oder die erlittenen Behinderungen und Repressalien zu bewältigen. Die nationalsozialistische Kulturpolitik hatte mit ihren restriktiven Maßnahmen zu einer starken thematischen Eingrenzung der Literatur geführt, die sozialdemokratisch ausgerichtete Literatur war von der Bildfläche verschwunden. Autoren dieser Generation waren Franz Tumler, Franz Pühringer und Karl Kleinschmidt.
Junge, kritische Autorengeneration – „Moralisten“
Die nach dem Krieg erstmals publizierende Generation setzte sich für eine geistige Neuorientierung ein und zeichnete sich durch ihren hohen moralischen Anspruch aus. In der Linzer Theaterszene der Nachkriegszeit versuchte sie ihren Stücken Gehör zu verleihen, war dort jedoch weniger erfolgreich als mit ihren Lyrik- und Prosawerken. Dieser Generation, die später großteils außerhalb des Landes tätig war, gehörten Autoren wie Kurt Klinger, Rudolf Bayr, Karl Wiesinger, Herbert Eisenreich und auch Marlen Haushofer an.
Nachkriegsgeneration – Existenzialisten
Jene Generation, die ab Mitte der 1950er Jahre Bedeutung erlangte, ist der Schule des Existenzialismus und dem absurden Theater zuzurechnen, als deren oberösterreichische Vertreter Franz Josef Heinrich und Oskar Zemme gelten. In diese Zeit fällt die erstmalige österreichische Aufführung Samuel Becketts „Warten auf Godot 1954 im Linzer Landestheater. Kennzeichen dieser Strömung ist eine pessimistische Weltsicht, die im Gegensatz zur allgemeinen wirtschaftswunder- und staatsvertragsbedingten Aufbruchstimmung steht.
Die Situation der Schriftsteller nach dem Krieg
Gemeinsam war allen Schriftstellern ihre finanzielle Notlage, die schließlich zur Gründung der „Notgemeinschaft Oberösterreichischer Schriftsteller“ im Jahr 1946 führte, zu deren Initiatoren Carl Emmerich Baumgärtel, Maximilian Narbeshuber und Carl Martin Eckmair zählen. Viele Literaten – unter ihnen auch Franz Kain und Arnolt Bronnen – konnten sich nur durch zusätzliche Tätigkeiten im publizistischen Bereich als Redakteure oder Journalisten über Wasser halten.
Oberösterreichische Verlagslandschaft
Während der Zwischenkriegszeit veröffentlichten österreichische Autoren ihre Werke überwiegend in Deutschland, was zu Kriegszeiten zunehmend schwieriger wurde. Nachdem 1945 der Wirtschaftsverkehr mit Deutschland vollends zum Erliegen gekommen war, wurde versucht – zumeist auf Initiative einzelner Autoren – in Oberösterreich ein eigenes Verlagswesen aufzubauen. Es entstand der Verlag Johann Schönleithner in Aichkirchen, der Ibis-Verlag, der vorwiegend alte Titel wieder auflegte, und Hans Muck bot jungen Autoren die Möglichkeit der Veröffentlichung ihrer Werke. Weitere Verlage waren Otto Stöbers Stadtverlag beziehungsweise Länderverlag, und im Brückenverlag verlegte Herbert Lange vorwiegend eigene Werke. Die meisten konnten sich nur kurz halten, und als mit 1950 das große Verlagssterben einsetzte, blieb nur Ibis als Trauner Verlag erhalten.
Mit dem Ende der freien Verlage begann in Oberösterreich die öffentliche Literaturförderung. Suventionierte Reihen der Stadt Linz boten oberösterreichischen Autoren die Möglichkeit zur Veröffentlichung ihrer Werke. Ab diesem Zeitpunkt wurde das Angebot nicht mehr vom Leser selbst, sondern durch die Auswahl von Kulturbeamten gelenkt.
Hörfunk – Hörspiele
Die 1940er und 1950er Jahre standen ganz im Zeichen des Hörfunks: Das zur Sendergruppe „Rot-Weiß-Rot“ gehörende Linzer Rundfunkstudio unterstand während der Besatzungszeit den Amerikanern und führte eine eigene Hörspielabteilung, was in der Publikationstätigkeit der Schriftsteller entsprechenden Ausdruck fand, da der Hörfunk höhere Honorare bot als die traditionellen Printmedien.
Neuer Heimatbegriff – Heimkehrerliteratur
Glaube und Hoffnung als wesentliche Werte der Vorkriegszeit spiegeln sich nach dem Krieg unter neuen Vorzeichen auch in der oberösterreichischen Literatur wider. Die Ernennung von Franz Stelzhamers Hoamatland zur oberösterreichischen Landeshymne im Jahr 1952 ist ein wichtiges Zeugnis für die gesellschaftliche Relevanz des Prinzips „Hoffnung“ jener Zeit. Eine neue Bedeutung hatte der Heimatbegriff durch die Kriegs-Heimkehrer der 40er und 50er Jahre bekommen, die auch literarischen Niederschlag fand: Hans Dibolds Tatsachenroman Arzt in Stalingrad ist diesem Genre ebenso zuzuordnen wie Franz Tumlers Landschaften des Heimgekehrten. Hanns Gottschalk greift die Heimatvertriebenenproblematik auf, Heimatsuche findet bei ihm in der Suche nach der „ewigen Heimat“ ihren Sinn. Kurt Klinger, dessen Drama Odysseus muss wieder reisen 1954 am Linzer Landestheater uraufgeführt wurde, lieferte eine intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Integrationsproblem der Heimkehrer und stellte Fragen nach Schuld und Verantwortung.
Dieser Text basiert auf einem Vortrag von Frau Dr. Helga Ebner „Vom Zusammenbruch zum Staatsvertrag. Literatur in Oberösterreich zwischen 1945 und 1955“, der am 18. Mai 2005 im Stifterhaus in Linz gehalten wurde.
Redaktionelle Bearbeitung: Elisabeth Kreuzwieser, 2005