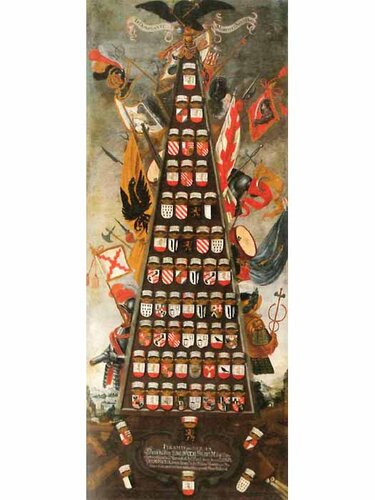Grundherrschaft und Wirtschaftsherrschaft
Kapitalisierung der Grundherrschaften
Am Beginn des 16. Jahrhunderts kam es zu einem Wandel des inneren Gefüges der Grundherrschaften, die Lage der Bauern verschlechterte sich in ganz Europa zusehends: Seit der Kolonisation bislang kaum erschlossener Gebiete hatten sie weniger Freiheiten, zudem ist die Tendenz zur Angleichung abgestufter Abhängigkeiten der Bauern zu beobachten; das Ziel war das Entstehen einer möglichst einheitlichen Schicht an Untertanen.
Feststellbar ist eine Erhöhung der dinglichen Leistungen (auch bei persönlich freien Bauern, z. B. das Besthaupt), aber auch die Umwandlung dinglicher Leistungen in Geldabgaben (Robotgeld statt Robot). Die Beschwerden der Bauern richteten sie vermehrt gegen die hohen Abgaben, die bei jeder Art von Besitzwechsel gefordert wurden. So betrug das Freigeld bei Besitzwechsel rund ein Drittel oder die Hälfte des Bauernvermögens.
Der Gesindezwang – ergangen in der landesfürstlichen Resolution von 1582 – verpflichtete die Bauern, ihre Kinder der Herrschaft für eine bestimmte Zeit als Dienstboten zur Verfügung zu stellen. Dem Anfeilzwang folgend mussten die Bauern zuerst der Herrschaft alle ihre Erzeugnisse wie Getreide, Leinwand, aber auch das Vieh für die Deckung des Eigenbedarfs anbieten. Die Herrschaften wollten sich so selbst den Handel sichern und gleichzeitig die Bauern weitgehend von den Märkten abhalten. Das gelang aber nicht immer, denn manche Bauern konnten trotz allem auf den Märkten zusätzlichen Verdienst erwirtschaften. Die Polizeiverordnungen gegen den Luxus der Bauern bei Kleidung und Essen kamen wohl nicht von ungefähr. So gab es im Land ob der Enns relativ häufig wohlhabende Bauern. Alfred Hoffmann vertritt daher die These, dass nicht unbedingt die wirtschaftlich schlechte Stellung der Bauern immer wieder zu Aufständen im Land ob der Enns geführt hat, sondern vielmehr die relativ gute Lage den Widerstandsgeist gestärkt hat. Dennoch stand eine sehr kleine, überaus wohlhabende Gruppe der großen Masse jener gegenüber, die äußerst bescheiden lebten. Dazu zählten Bauern ebenso wie Handwerker und Tagelöhner.
Ausbildung der Wirtschaftsherrschaft
Die Tendenz zur Kapitalisierung der Grundherrschaft und ihres Untertanenverbandes ging einher mit der Ausbildung der Wirtschaftsherrschaft, wie Hoffmann sie bezeichnet. Darunter versteht er eine Mittelstellung zwischen der alten Renten- und der neuen Gutsherrschaft. Dabei blieb der größte Teil des nutzbaren Landes auf die selbstständigen bäuerlichen Wirtschaften verteilt, gleichzeitig kam es aber zu einer stärkeren Zentralisierung der Abgabenverwaltung und einem vermehrten Heranziehen zu Dienstleistungen für die Herrschaft. Das Ziel war, einen relativ einheitlichen ökonomischen Verband zu etablieren. Daher bestand das Bestreben der Gutsherrschaften, möglichst geschlossene Besitzflächen zu erhalten und eine weit reichende wirtschaftliche Autonomie (monopolisierter Binnenmarkt) zu erlangen. Der Aufstieg der politischen Stände ging also mit dem gleichzeitigen Bemühen einher, eine auf der Grundherrschaft basierende, wachsende Wirtschaftsmacht zu etablieren. Andererseits wurde mit der Religionskonzession des Jahres 1586 gleichzeitig auch das Landesfürstentum entmachtetet, indem den Ständen darin eine Reihe wirtschaftlicher Zugeständnisse gemacht wurde.
Die bäuerlichen Untertanen
Obwohl im 16. Jahrhundert meist von einer Vermindung der Anzahl selbstständiger Bauerngüter und einer vermehrten Bindung der Bauern an die Grundherrschaft gesprochen wird, blieb im Land ob der Enns der überwiegende Teil des Ackerlandes in der Nutzung der Bauern. Außerdem kam es im 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu einer Vermehrung der Bevölkerung und in der Folge auch zu einer Zunahme an Wohnstätten. So entstanden zahlreiche kleine „Häusel“, deren Bewohner sich meist mit Viehzucht fortbrachten. In wirtschaftlichen schlechten Zeiten waren es aber gerade die Bewohner dieser „verschwiegenen Güteln“, welche in die Stadt zogen und dort als Bettler ihr Dasein fristeten.
Daneben bildeten die so genannten Inleute eine eigene Schicht der landwirtschaftlichen Bevölkerung. Sie verfügten nicht über Haus- und Grundbesitz und verdingten sich als Dienstboten und Tagelöhner. Gerade diese bildeten in den Bauernaufständen ein radikales Element.
Im Zusammenhang mit dem Zuwachs an Wohnstätten sind in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts im Land ob der Enns zahlreiche Rodungen zu beobachten, etwa in den recht ansehnlichen Waldgebieten im Mühl- und Machlandviertel. Gleichzeitig wurden bisher öde Heiden kultiviert, etwa die Welser Heide. Gerade in Zeiten der Religionsemigration im 17. Jahrhundert bemächtigten sich Menschen dort ohne jedes Entgelt unbesiedelten Bodens.
Der Beitrag basiert im Wesentlichen auf: Hoffmann, Alfred: Wirtschaftsgeschichte des Landes Oberösterreich. Bd. 1. 1952. Redaktionelle Bearbeitung: Klaus Landa, 2010