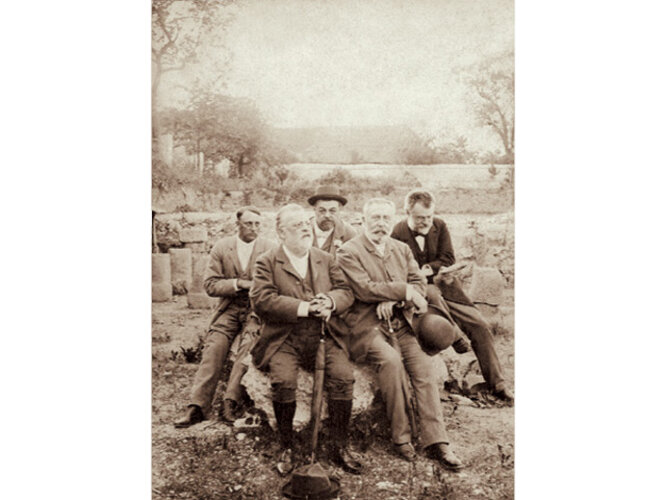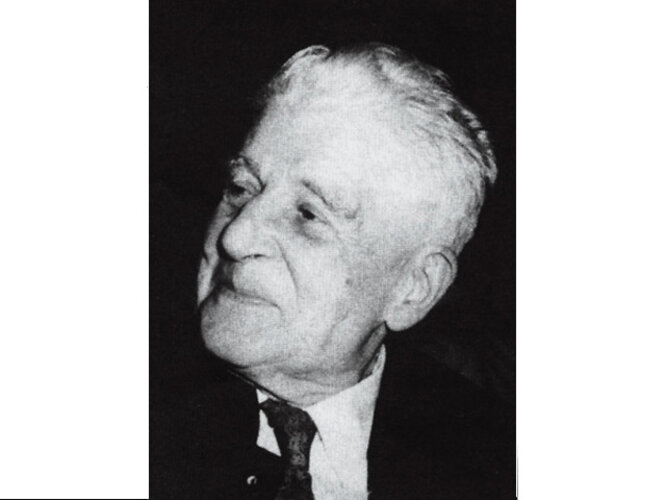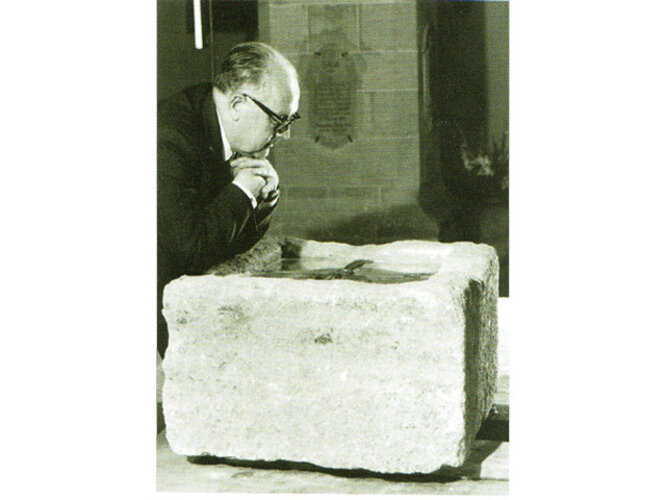Erste römerzeitliche Funde
Die ersten Nachrichten über Funde aus der Römerzeit in Oberösterreich liegen weit vor der Wiederentdeckung der Antike im Zeitalter der Renaissance und sind zumeist in Chroniken von Stiften und Klöstern erhalten geblieben. In den Geschichtsquellen des Stiftes Kremsmünster vermerkte beispielsweise der Mönch Berchtold, später als Bernardus Noricus bezeichnet, dass um 1300 bei der Renovierung der Kirche von Lorch an der Ostseite des Gotteshauses einige mit Reliefs und Inschriften versehene Römersteine freigelegt wurden.
Nach einem Ausbleiben vergleichbarer „Fundmeldungen“ wurde den Inschrift- und Reliefsteinen sowie den „heidnischen Pfenningen“ erst ab dem 15. Jh. wieder größeres Augenmerk geschenkt. Als der so genannte Antiquus Austriacus um 1500 die erste größere Sammlung römischer Inschriften aus Österreich anlegte, nahm er bereits sechs epigraphische Denkmäler aus Oberösterreich auf: die schon lange bekannte Inschrift aus Lorch, eine aus Lambach und je zwei aus Wels und Bad Ischl.
Der Bayerische Historiograph Johannes Turmayr, genannt Aventinus (1477–1534) berichtet in seiner Baierischen Chronik allerlei Wissenswertes über die Verhältnisse in Oberösterreich zur Römerzeit. Neben den Abschriften von drei Inschriften aus Mondsee und einer aus „Ovilava“, das er für Lambach hält, teilt er den Fund eines Weihesteins aus Haselbach bei Braunau mit.
16. und 17. Jahrhundert
Beachtenswert ist, dass Reichart Strein von Schwarzenau (1538–1600) in seinen Annales historici oder Historisch Jarzeit Buech des Ertzherzogthums Österreich ob der Ennß, die man als den ersten Versuch einer Landesgeschichte von Oberösterreich ansehen kann, auch römische Inschriften, wie unter anderem den heute leider verlorenen Meilenstein von Engelhartszell, berücksichtigt.
Im 16. und 17. Jahrhundert widmeten sich einige oberösterreichische Adelige mit großem Eifer der Sammlung römischer Altertümer.
18. Jahrhundert
In den Sechzigerjahren des 18. Jahrhunderts kam es zu einer ganzen Reihe von bedeutenden Funden: Im Jahre 1760 fanden Holzknechte in der Nähe von Bad Goisern einen Schatz von mehreren hundert römischen Silbermünzen, der allerdings eingeschmolzen wurde. Trotz mehreren römischen Funden (ein Mosaikfußboden nahe der Lorcher Kirche, römische Baurreste in Lochau bei Mattighofen und in Weyregg am Attersee) kam es zu keiner näheren Auseinandersetzung mit der Hinterlassenschaft der Römerzeit in Oberösterreich.
19. Jahrhundert: Besinnung auf die eigenen Wurzeln
Ein entscheidender Wandel erfolgte erst am Beginn des 19. Jahrhunderts im Zuge der erwachenden Besinnung auf die Wurzeln des eigenen Volkstums und die Grundlagen der geschichtlichen Vergangenheit im Zusammenhang mit dem sich zu dieser Zeit etablierenden Nationalismus.
Ein kaiserlicher Erlass aus dem Jahre 1812, in dem die Ablieferung aller Arten von Bodenfunden an das k.k. Münz- und Antikenkabinett in Wien verordnet wurde, verdeutlicht diese neue Gesinnung. Etwas später erfolgte eine Weisung, dass aufgefundene römische Inschriftsteine in die Außenwand der nächstgelegenen Kirche einzumauern seien. Der veränderten Geisteshaltung entsprach auch das Bemühen, sich einen Überblick über die erhaltenen Reste der Vergangenheit zu verschaffen und die vorhandenen Fundgegenstände zu registrieren. Dafür charakteristisch ist die 1827 bis 1833 in vier Bänden erschienene Geschichte, Geographie und Statistik des Erzherzogthums Österreich ob der Enns und des Herzogthums Salzburg von Benedikt Pillwein (1779–1847), in der bereits eine Fülle römerzeitlicher Bodenfunde, oft ganz bescheidener Art, verzeichnet sind.
Gründung von Landesmuseen
Das Bestreben die vorhandenen Denkmäler der Vergangenheit zu sammeln und zu konservieren, führte zur Gründung von Landesmuseen: 1811 Joanneum in Graz, 1823 Ferdinandeum in Innsbruck. In Linz erfolgte im Frühjahr 1833 die Gründung des Museum Francisco-Carolinum und die Konstituierung des „Vereins des vaterländischen Museums für Österreich ob der Enns“ (später „Oberösterreichischer Musealverein“), der in seinen Statuten ausdrücklich die Absicht kundtat, in seine „Sammlung historischer Denkwürdigkeiten“ auch solche einzubeziehen, die „die römische Vorzeit“ betreffen.
Neue Grabungsmethoden
Eine bedeutende Figur für die Verwirklichung der Ziele des neu gegründeten Museumsvereines war der schließlich den Titel „Vater der oberösterreichischen Altertumsforschung“ erhalten hatte, war der Florianer Chorherr und Professor für lateinische Philologie und Weltgeschichte am Linzer Gymnasium Josef Gaisberger (1792–1871). Unter ihm erfolgte erstmals eine wissenschaftliche Erfassung und Auswertung des Fundmaterials, das durch die intensive Bautätigkeit beim Straßen- und Eisenbahnbau, bei der Kanalisierung und bei der Donauregulierung vermehrt zum Vorschein kam und die Sammlungsbestände des Museums Francisco-Carolinums bereicherte. Unter Gaisberger erfolgten außerdem die ersten planmäßigen Ausgrabungen in Oberösterreich. Zwar brachten diese in den Jahren 1838 bis 1840 in Schlögen und 1841 in Oberranna erfolgten Grabungen nur wenige spektakuläre Funde, jedoch ist ein Kennzeichen fortschrittlicher Arbeitsmethoden die durch Gaisberger geförderte Beigabe eines Lageplans.
Obwohl sich Josef Gaisberger nach fast vierzigjähriger Lehrtätigkeit schon 1856 in sein Stift St. Florian zurückgezogen hatte, blieb er bis zu seinem Tode (1871) der getreue Mentor der oberösterreichischen Altertumsforschung. Als einer seiner Nachfolger, die sich mit großem Eifer der Erforschung der Bodenfunde widmeten, ist der Postbeamte Josef Straberger (1836–1905) zu nennen, der von 1880 bis 1905 als Kustos der vorgeschichtlichen und römischen Abteilung am Museum Francisco-Carolinum, das seit 1896 ein neues Gebäude bezogen hatte, wirkte.
Musealverein Enns und Stadtmuseum Wels
Die Bedeutung des Linzer Museums als Zentrum der provinzial-römischen Forschung war jedoch gegen Ende des 19. Jahrhunderts zurückgegangen, als 1892 der Musealverein für Enns und Umgebung (heute Museumverein Lauriacum) und 1902 das Stadtmuseum Wels gegründet wurden. Dort bemühte sich Stadtrat Franz von Benak (1838–1919) um die Erforschung und Erhaltung der römischen Altertümer.
Von der Laienforschung zur Professionalisierung
Ein allgemeiner Höhepunkt in der Begeisterung für Ausgrabungstätigkeiten wurde im Jahre 1841 erreicht, als ein an die Kreishauptleute errichteter Präsidialerlass, die „Ermunterung zur archäologischen Ausgrabungen“ aussprach, um die Bestände des Linzer Museums zu vermehren. Problematisch an der zahlreich ausgeübten Laienforschung und den unkontrollierten Grabungen, die mangels Erfahrung vieles zerstörten, war außerdem die mangelnde Dokumentation und Kenntnis eines fachlichen Umgangs mit den Fundobjekten, wodurch wertvolle Informationen für immer verloren gingen. Aus diesem Grund erwies es sich als günstig, dass sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in zunehmendem Maße in Wien lebende Gelehrte in die archäologische Forschung einbrachten. Hier ist beispielsweise der Direktor des Münz- und Antikenkabinetts Joseph von Arneth (1791–1863) zu nennen, der nicht nur einen ausführlichen Bericht über die Aufdeckung des Hypokaustums in Lorch verfasst hat, sondern auch die von der Akademie der Wissenschaften veranlassten Grabungen in der Lahn bei Hallstatt (1858/59) publizierte. Weitere Leiter des Münz- und Antikenkabinetts in Wien waren Eduard von Sacken (1825–1883) und dessen Nachfolger Friedrich Kenner (1834-1922). Besonders Kenner, als gebürtiger Oberösterreicher, schaltete sich oft in die provinzialrömische Forschung seiner Heimat ein.
Er berichtete laufend über Neufunde, beschäftigte sich mit den Problemen der Römerstraßenforschung und fasste in einer eigenen Abhandlung die Forschungsergebnisse der römischen Siedlung von Hallstatt zusammen.
Nach der Jahrhundertwende befasste sich u.a. Wilhelm Kubitschek (1856–1936) mit Detailproblemen der provinzialrömischen Forschung im Donauraum.
Enns-Lorch
Als Mittelpunkt der Forschungstätigkeit galten aber nach wie vor die beiden wichtigen Fundorte Lorch und Wels. Bald nach seiner Gründung führte der Ennser Museumsverein unsachgemäße Grabungen im Lagergelände durch, wobei das schon 1851/52 angeschnittene Hypokaustum weitgehend zerstört wurde. Eine entscheidende Wende ergab sich als im Jahr 1904 Oberst Maximilian von Groller (1838–1920) mit der Grabungsleitung in Lorch betraut wurde. Durch die bis 1919 fortgeführten Arbeiten konnten Anlage und Inneneinrichtung des Lagers der 2. Italischen Legion im Wesentlichen klargestellt werden. Ergänzende Nachforschungen in den 1930er Jahren durch Alexander Gaheis (1869–1942) und Josef Schicker (1879–1949) rundeten das Bild noch weiter ab. Erich Swoboda (1896–1964) legte 1935 westlich des Laurenzifeldes eine Badeanlage und 1936 bei der 1792 abgerissenen Maria-Anger-Kirche das Lagerspital (valetudinarium) mit den Resten einer später eingebauten frühchristlichen Kirche bei.
Im Zeitraum von 1951 bis 1960 erfolgte im Zusammenhang mit nachkriegszeitlichen Bauvorhaben eine Großgrabung im Bereich der Ennser Zivilsiedlung unter der Leitung von Wilhelm Jenny, Hermann Vetters und Lothar Eckhart, die bedeutende Erkenntnisse über die Anlage, die Bauten und das Straßennetz der zum Legionslager gehörenden Siedlung brachte. Eine daran anschließende Grabungskampagne (1960–1966) in der Lorcher Laurentius Basilika, die insbesondere durch den Lorcher Pfarrherrn Eberhard Marckhgott Unterstützung erfuhr, entwickelte sich zu einer höchst aufschlussreichen Unternehmung.
Ab den 1960er Jahren erfolgten außerdem im Ennser Stadtgebiet Notgrabungen unter der Leitung von Herbert Kneifel bzw. seit 1971 unter Hannsjörg Ubl, welche die Ergebnisse der bisherigen Grabungen und insbesondere zu der zugleich mit dem Legionslager planmäßig angelegten Zivilstadt (Lauriacum II) wesentlich erweitern und ergänzen konnten.
Wels
Ferdinand Wiesinger (1864–1943), dem Direktor des Welser Stadtmuseums, gelang es durch seine 1917 bis 1919 planmäßig betriebene Bodenforschung und die Auswertung aller Bodenbewegungen im dicht verbauten Bereich der modernen Stadt Klarheit über die Topographie des römischen Wels zu gewinnen. Seine Nachfolger Gilbert Thrathnigg (1911–1970) und Kurt Holter (1911–2000) setzten ebenfalls auf die Klärung topographischer Fragen auf Basis von Notgrabungen. Erst seit den 1990er Jahren konnten wieder planmäßige Grabungen durchgeführt werden, deren Ergebnisse unter der neuen Leiterin des Städtischen Museums Renate Miglbauer publiziert werden konnten. Die Sammlungen des Welser Stadtmuseums sind seit 2002 im renovierten ehemaligen Minoritenkloster untergebracht.
Regionale Forschungen
Aber nicht nur in Lorch und Wels wurde römerzeitliche Forschung betrieben. Die Hauptlast der Forschungstätigkeit in Hallstatt trug seit dem 1. Weltkrieg Friedrich Morton (1890–1969), der sich in unzähligen Veröffentlichungen mit der Hallstattkultur, aber auch mit den Überresten der Römerzeit auseinandersetzte. Eine größere Grabung führte 1940 zur Freilegung der sog. „Villa am Selzbergwege“ in der Lahn an der Nordseite des Echertales.
Im Innviertel beschäftigte sich vor allem der Braunauer Hugo von Preen (1854–1941) mit der Römerzeit seiner engeren Heimat.
In Linz bemühte sich besonders Paul Karnitsch-Einberger (1904–1967) um die Klärung der Topographie des antiken Lentia. Er barg in den Jahren 1926/27 etwa 150 Gräber eines früh- und mittelkaiserzeitlichen Urnenfriedhofes auf dem Gelände der Kreuzschwesternschulen. Die Ergebnisse seiner weiteren Grabungen in der bombenzerstörten Linzer Altstadt wurden posthum veröffentlicht, blieben aber nicht unwidersprochen.
Weitere Grabungsprojekte
Auch in anderen Orten Oberösterreichs fanden in der unmittelbaren Nachkriegszeit Grabungsprojekte statt: Im sogenannten Totenhölzl bei Bad Wimsbach-Neydharting legte Hermann Vetters 1950/51 ein Gebäude einer villa rustica frei und auf dem Georgenberg bei Micheldorf versuchte er von 1953 bis 1956 gemeinsam mit Kurt Holter im römischen Tutatio ein Kontinuum von Kult und Siedlung nachweisen. In Schlögen brachten die Grabungen der Jahre 1957 bis 1959 durch Lothar Eckhart die Gewissheit, dass die von Gaisberger aufgestellte Hypothese, das dortige Kleinkastell mit dem Lagerdorf Ioviacum gleichzusetzen, nicht länger gehalten werden kann.
Erforschung ländlicher Gebiete
Die römerzeitlichen Forschungen der letzten Jahrzehnte, die insbesondere zu den drei großen Ausgangsstätten Lauriacum, Ovilavis und Lentia beachtenswerte Ergebnisse brachten, bildet zum Hinterland des Donaulimes ein Desideratum.
Bedeutende jüngere Forschungsansätze haben wir jedoch Christine Schwanzar zu verdanken, die 1984 die Abteilung Römerzeit am Oö. Landesmuseum übernahm. Ihre Grabungen an verschiedenen Orten Oberösterreichs (Fraham, Hirschleitenbach im Kürnbergwald, Thalham bei Schönering, Windischgarsten, u.a.) brachten beachtenswerte Ergebnisse. Auch die archäologische Mittelalterforschung in Oberösterreich geht auf Christine Schwanzar zurück.
Weiters ist das Institut für klassische Archäologie der Universität Wien zu nennen, das seit den 1990er Jahren archäologische Grabungen im Gebiet des Unteren Inn veranstaltete, bei denen im Gemeindegebiet von Altheim Gutshöfe in Simetsberg, Weirading und Wagham erforscht und wichtige Erkenntnisse zum römischen Landleben am Unteren Inn gewonnen werden konnten. Beim Bau der sogenannten Welser Westspange in Oberschauersber/Steinhaus wurde eine weitere villa rustica mit einem Ziegelofen entdeckt.
Autor: Gerhard Winkler, 2006