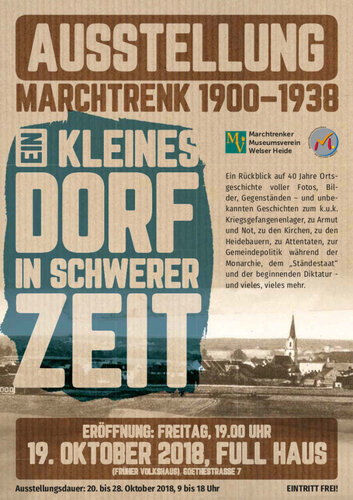Als „vergessene Stadt“ wurde Freistadt in einem Roman aus dem Jahr 1913 bezeichnet. Dieser berichtet von der Zurückgezogenheit der Bürger, über das idyllische Leben und Streben der Leute abseits von hektikmodernem Leben. Teilweise wird dieses Bild auch auf Freistadt zugetroffen haben, aber es hat auch ganz andere Bestrebungen in dieser Stadt gegeben. Man wollte durchaus nicht den Zug der Zeit verpassen und den damaligen Bürgermeistern Paul Obermayr, Ludwig Gruber und Theodor Josef Scharizer konnte man keine Weltfremdheit nachsagen. Alle drei versuchten mit allen Mitteln eine Modernisierung der Stadt sowie eine Anpassung an die neuen Verhältnisse zu erreichen. Diese neuen Verhältnisse verlangten ein gediegenes Angebot an Schulen, eine Anbindung an das weltweite Verkehrsnetz, eine Verbesserung der sozialen Lage und der hygienischen Verhältnisse sowie die Schaffung von zeitgemäßen Freizeiteinrichtungen. Die Vorgaben wurden auch realisiert: Es wurde eine Hochquellwasserleitung für die Stadt gebaut, zwei höhere Schulen und ein Gaswerk für Beleuchtungszwecke errichtet, die Garnison in der Schlosskaserne wurde unterstützt und die Kultur- und Sportvereine gefördert.
Eine kleine Gruppe von Stadtbürgern konnte und wollte sich bereits längere Urlaube und Auslandsaufenthalte leisten. Für so manche Freistädter lautete damals schon die Devise „Ans Meer“. So traf man sich regelmäßig in Abbazia oder Grado. Auch mehrtägige Wanderungen im Salzkammergut oder im Böhmerwald waren an der Tagesordnung.
Doch die Bevölkerung lebte vorwiegend von der Landwirtschaft und vom Kleingewerbe. Nur wenige Beamte (Verwaltung und Eisenbahn) hatten regelmäßige Einkünfte und bezahlte Urlaubstage. So ersetzte das Vereinswesen vielfach die Urlaubsreisen. Neben den traditionellen Vereinen, wie Sport- und Musikvereinen, tauchten auch neue, etwas exklusivere Vereine auf: etwa der Radfahrverein Freistadt, dessen Mitglieder mit ihren Rädern neben kürzeren Tagesausflügen auch Österreich-Rundfahrten veranstalteten. Es gab auch bereits vor dem Ersten Weltkrieg einen Tennisverein in Freistadt. Der Platz war ein nach englischem Vorbild gestalteter Lawn-Tennis-Platz. Die weniger Sportlichen fanden sich in geselligen Vereinen, wie etwa der Landsturm-Tischgesellschaft und den Wikingern. Diese trafen sich regelmäßig in den diversen Gasthäusern, um neben dem Bierkonsum auch noch für karitative Zwecke zu sammeln.
Um den Anschluss an die übrige Welt nicht zu verpassen, wurden neue Verkehrswege erschlossen und die alten ausgebaut und verbessert. Aus den biedermeierlichen Chausseen wurden leistungsfähige Überlandstraßen. Die Eisenbahnprojekte wurden besonders ehrgeizig verfolgt, viele Ausbaupläne hat aber der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zunichte gemacht. Freistadt war also eine Kleinstadt, wie es vermutlich hunderte in der großen Donaumonarchie gegeben hat. Der Blick auf das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner eröffnet uns einen Mikrokosmos, der vermutlich typisch für eine Provinzstadt war, aber trotzdem heute in vielen Details vergessen ist.