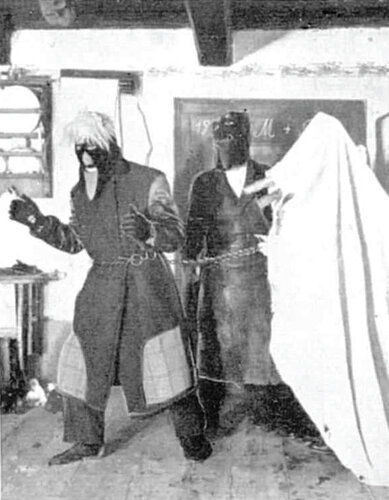Sonnenwende: Schon in frühgermanischer Zeit kannte man Sonnenkulte, die Sommer- und Wintersonnenwende dürfte an ein zweigeteiltes Jahr erinnern. In christlicher Zeit ersetzte man die beiden Feste durch Weihnachten und das Johannesfest. Die Feuer sollten ursprünglich böse Geister vertreiben. Das Holz für das Feuer wird mit bestimmten Sprüchen eingesammelt.
In manchen Gemeinden des Inn- und Hausruckviertels brannte man Feuerräder ab, ein Brauch, der auch in der Mettennacht zur Wintersonnenwende üblich war.
Überliefert sind solche Feuerräder aus Peuerbach, Aistersheim, St. Georgen bei Grieskirchen, Taufkirchen an der Trattnach, Wendling und Geboltskirchen. In letzterem Ort wurden sie aber in der Mettennacht abgerollt und von Mägden für Spuk gehalten.
Wer neun Feuer sieht, stirbt nicht oder heiratet in diesem Jahr, meinte man. Neunmaliges Feuerspringen schütze vor Kreuz- und Fußweh und der Acker freue sich neun Jahre danach. Ab Mitternacht allerdings würden die Hexen über das Feuer springen.
Erntebrauchtum: Kornfeldbeten war in Peuerbach, Aistersheim, Gaspoltshofen, Geboltskirchen, Hofkirchen an der Trattnach und Weibern üblich. In Geboltskirchen besprengte man den Lagerort des Weizens mit Weihwasser gegen Blitzschlag. Dem letzten Bauern, der die Ernte einbrachte, stellte man eine Habergeiß aufs Feld. Stürzte ein Erntewagen um, gab es den Brauch des „Kapellenbauens“, der so hieß, weil man an der Unglücksstelle kleine Kreuzchen aus Bindfaden und Stroh aufstellte. Die Verursacher bekamen Spottlieder und „Trutzgsangln“ zu hören.
Autoren: Irene und Christian Keller, 2014
Glaube? Aberglaube? – Volksfrömmigkeit - Dokumentation der Ausstellung im Kulturgut Hausruck vom 26. April bis 2. November 2014 und 2017.