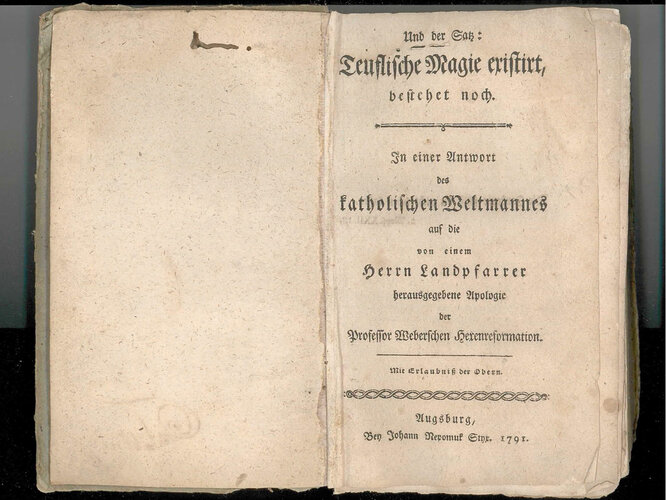Das magische Weltbild ist bestimmt durch vier magische Prinzipien:
1. Ähnlichkeit (Sympathieglaube): Alles ist mit allem verbunden. Dieser Glaube führt zu der Annahme, dass Gleiches wieder Gleiches bewirkt. Man bedient sich dieses Gesetzes, wenn man mit einer Nadel in eine Wachspuppe sticht, um einem Feind damit Schmerz zuzufügen oder einen roten Stein zum Blutstillen verwendet.
2. Gegensatz, Antipathie: Durch eine gegenteilige Handlung kann man ein Gleichgewicht wieder herstellen, durch Kühlen eine Verbrennung lindern.
3. Kontiguität oder Übertragungsmagie: Ein Teil wird für das Ganze genommen. Eine Hexe braucht nur ein Haar, um die ganze Person zu verhexen, der Gläubige nur eine Reliquie des Heiligen, um in den Genuss seiner segensreichen Kraft zu kommen.
4. Nachahmung oder mimetische Magie: Durch Nachahmen eines Vorgangs erzeugt man dasselbe wie mit dem Vorgang selbst. Das Melken aus einem Axtstiel gehört in diese Gruppe.
Einzelne Prinzipien überschneiden sich oft oder sind in einem Zauber gleichzeitig wirksam.
Eine Einteilung in Schwarze (Goetie) und Weiße Magie (Theurgie) besteht schon seit dem Mittelalter. Weiße Magie hat ein gutes Ziel, Schwarze ist antisozial, zu ihr gehören alle Arten des Schadenszaubers. Für sie benötigt man einen Teufelspakt. Volksmagie und Gelehrtenmagie beeinflussten einander wechselseitig. Die Gelehrtenmagie hat eine wesentlich kompliziertere Theorie, die Volksmagie basiert auf den oben genannten Prinzipien, besonders auf dem der Ähnlichkeit. Oft sank die Gelehrtenmagie ins Volk ab und wurde dort stark vereinfacht.
Magie und Religion sind oft schwer zu trennen und waren in vorchristlicher Zeit auch nicht voneinander getrennt. Viele ältere religiöse Praktiken, wie z.B. das Waffensegnen, beinhalten magische Elemente, dagegen bediente sich z.B. das Schatzbeten christlicher Gebetsformeln.
Der ganz große Unterschied ist, dass Magie die überirdischen Mächte zwingen will, das Gebet dagegen die letzte Entscheidung immer Gott überlässt. Um Grenzen, was erlaubt und was verboten ist, rang die Kirche schon seit frühester Zeit. In Bußordnungen aus dem 8. Jh. werden verbotene Praktiken aufgezählt, der Hexenhammer aus dem 15. Jh. erklärt z.B., das Tragen von Reliquien sei erlaubt, das von Zetteln und Sprüchen sei verboten.
Für die Erlaubtheit von Segen sind sieben Bedingungen notwendig:
1. Die Worte dürften nichts enthalten, was auf eine ausdrückliche oder schweigende (dem Sprecher ist egal, wer die Hilfe bewirkt) Anrufung der Dämonen hinausläuft.
2. Die Sprüche oder Segen dürften keine unbekannten Namen enthalten. Dazu gehört z.B. das im Schlangensegen vorkommende Wort „Osig“.
3. Der Wortschatz dürfte keine Täuschungen enthalten, z.B. durch Reime, Sprachrhythmus oder durchgeführte Handlungen. Beim Wurmsegen verwendete man z. B. einen Pfeil, in den man durch Gesten den „Wurm“ (die Entzündung) zog und den man dann in den Wald schoss, beim Wenden wurden Trogscherer oder Äpfel verwendet.
4. Es sollten keine Zeichen enthalten sein, außer dem Zeichnen des Kreuzes. Drudenfüße etc. gehörten in die Gruppe der verbotenen Zeichen.
5. Die Art der Schrift sollte keine Rolle spielen. Man solle nicht glauben, dass eine besondere Art der Schrift etwas bewirke. Diese Forderung wendet sich gegen die magischen Sprüche mit Buchstabenkombinationen wie die Sator-Formel. Der von der katholischen Kirche geduldete Benediktussegen enthält zwar auch Buchstaben, sie sind aber nur Abkürzungen für Gebete und Heiligennamen.
6. Man müsse beim Sprechen heiliger Worte nur auf deren Sinn achten.
Autoren: Irene und Christian Keller, 2014
Glaube? Aberglaube? – Volksfrömmigkeit - Dokumentation der Ausstellung im Kulturgut Hausruck vom 26. April bis 2. November 2014 und 2017.