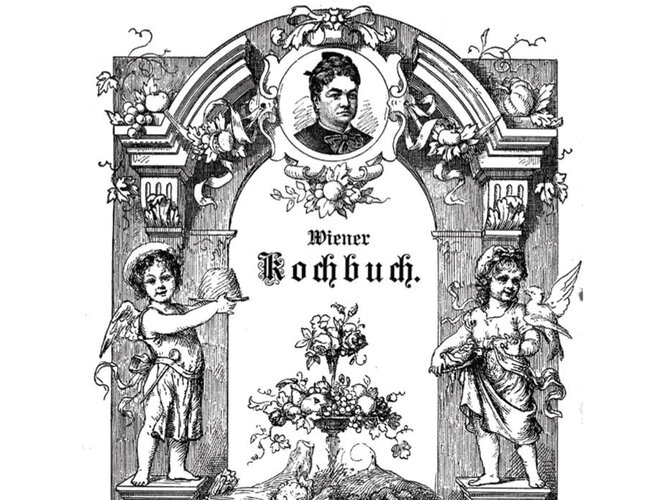Klösterliches Küchenerbe. Wie Minoritensuppen oder Karmelitertorten in die Kochbücher eingemeindet wurden
Vom Kochen im Dunstkreis von Kirche und Klöstern zeugen noch heute einzelne Gerichte bzw. Speisen wie Franziskanernudeln, Heidensterz, Kapuziner, Kardinalsschnitten, Karmelitertorte, Ketzersuppe, Lutherische Eyer in Schmalz, Martinigansl, Minoritensuppe, pikante Nonnen Förtzel, Prälaten-Semmeln oder der Weihnachtsstollen. Darüber hinaus sorgte das klösterliche Küchenlatein des Küchenpersonals, das von Latein und Italienisch gespeist wurde, für spezielle Küchenbegriffe, die vielfach noch heute gebräuchlich sind. So wurden etwa aus dem zweifach gebackenen Brot, dem lateinischen bis coctus (panis), Biskotten. Aus vielen historischen Kochbüchern spricht noch heute diese „sprechende geistliche Küche“.
In Geschichten und Anekdoten wurde manche kulinarische Spezialität nachträglich historisch zu nobilitieren versucht, wie etwa die Salzburger Nockerl, die Salome Alt ihrem Geliebten, dem Salzburger Erzbischof Wolf Dietrich von Raitenau (1559–1617), erstmals zubereitet haben soll, was allein schon in Anbetracht der dafür notwendigen konstanten Ofenhitze wenig glaubhaft erscheint.
Ende des 18. Jahrhunderts bereicherten die böhmischen Mehlspeisen wie auch die ungarischen Einflüsse die Klosterkost. Es ist dies auch die Zeit der ersten publizierenden Klosterköchinnen, die ihr immenses praktisches Wissen nun auch weitergaben, was für manche einem Verrat an dieser einst geheimen Kunst gleichkam.
Autor: Hannes Etzlstorfer, 2007
Kulinarisches Kloster. Zwischen Festmahl und Fastenküche - Dokumentation zur Ausstellung im Stift Schlägl/Meierhof vom 25. Mai bis 30. September 2007.