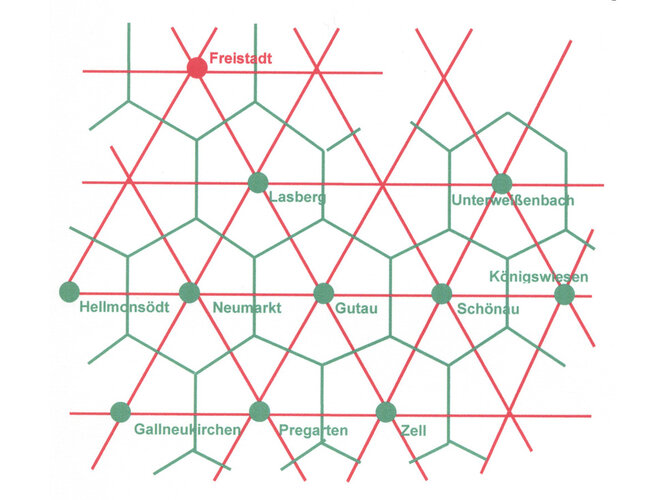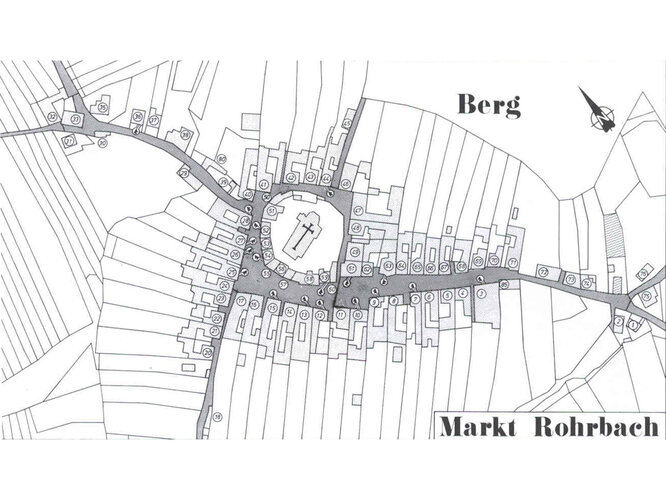Das römische Straßennetz blieb das Grundgerüst des mittelalterlichen Landverkehrs. Die römerzeitliche Traunbrücke bei Wels blieb bis ins 12. Jahrhundert erhalten und wurde dann durch einen mittelalterlichen Bau ersetzt. Ähnlich dürfte es sich bei Vöcklabruck verhalten haben, das 1134 erwähnt wird. Die römische Brücke über die Enns bei Lorch war 1064 nicht mehr vorhanden. 1191 gab es dort aber wieder eine Brücke. Die Traunbrücke von Ebelsberg ist 1215 belegt. Donaubrücken gab es im Hochmittelalter östlich von Regensburg noch keine. Man bediente sich der Furten und Überfuhren.
Zwei wichtige Handelsrouten erreichten in römischer Zeit von Aquileja ausgehend den Donauraum, einerseits die Verbindung, die durch das Kanaltal weiter über das Zollfeld, den Neumarkter Sattel, den Triebener Tauern und den Pyhrnpaß an die Donau führte, und andererseits die uralte Straße, die am Rande der Alpen von Aquileja über Görz, Laibach, Cilli, Pettau, Steinamanger und Ödenburg, der Trasse der alten Bernsteinstraße folgend, bei Carnuntum die Donau erreichte und damit das Gebirge überhaupt umging. Die östliche Route verlor infolge der politischen Situation in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends immer mehr an Bedeutung. Um so wichtiger wurde die Verbindung von Villach über St. Veit, Friesach, Neumarkt und Judenburg nach Steyr und Enns oder Wels und Linz.
Die Bedeutung, die der Pyhrnroute im 9. und 10. Jahrhundert als Handelsweg zukam, wird durch die Hinweise auf zahlreiche, aus Ortsnamen entlang dieser Strecke erschlossene Judenniederlassungen unterstrichen, die wohl als Raststationen zu deuten sind.
Kurzfassung (2007) aus: Sandgruber/Katzinger/Pisecky/Kerschbaummayr: Der Handel in Oberösterreich. Tradition und Zukunft. Linz 2002.