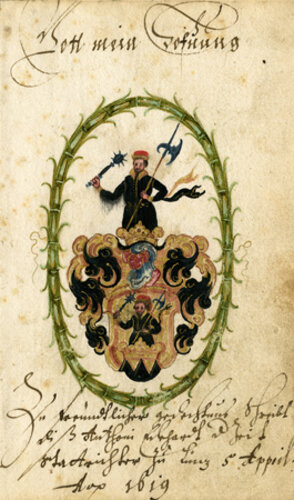Gegenstände der hohen Gerichtsbarkeit waren seit dem 12. Jahrhundert Freiheits- und Liegenschaftsstreitigkeiten sowie Friedensbruch. Die hohe Gerichtsbarkeit konzentrierte sich langsam auf jene Delikte, auf die Leibes- oder Lebensstrafen standen (Blutgerichtsbarkeit). Die Befugnis, das Jus Gladii oder die Blutgerichtsbarkeit auszuüben, wurde vom Landesfürst an die Inhaber der dafür zuständigen Landgerichte (Blutbannleihe) übertragen. Seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts bis 1848 gibt es zusätzlich noch den landesfürstlichen Bannrichter, der eine gewisse Kontrollfunktion in diesen Blutsachen ausübte. Die Blutgerichtsbarkeit für die adeligen Landstände wurde von einem speziellen Landgericht („Adeliches Criminal-Judicium“) unter dem Vorsitz des Landeshauptmannes ausgeübt.
Der Zentralraum Linz, Wels, Steyr
Linz und seine städtische Verwaltung
Der Landesfürst war seit dem hohen Mittelalter der oberste Inhaber der Gerichtsgewalt, die er weiter delegierte. Gemäß einer Urkunde von 1242 wurde ein eigener Stadtrichter mit zivil- und strafrechtlichen (Niedergerichtsbarkeit) sowie administrativen Aufgaben eingesetzt. Der territoriale Wirkungsbereich des Stadtgerichtes wurde von „Burgfriedsäulen“ markiert und „Frieden“ genannt. Seit 1426 durfte der Stadtrichter von den Bürgern gewählt werden und 1453 wurde ihm auch die hohe Gerichtsbarkeit (Blutgerichtsbarkeit) übertragen. Ab 1490 war der Stadtrichter, durch die Einführung des Bürgermeisteramtes, auf die Zivil- und Strafsachen beschränkt.
Autor: Gernot Kocher
Der sogenannte "Wasserturm" in Linz war das Gefängnis des ehemaligen K. K. Landgerichtes "Donauthal". Gleichzeitig diente es als Wohnung des Scharfrichters, weshalb der Wasserturm oft auch Henkerturm oder Freimannstöckel genannt wurde. In der Häuserchronik 1771 gibt es zum "Wasserturm" den Vermerk "Sieh Dich vor!".
Wels und seine städtische Verwaltung
Seit dem 16. Jahrhundert besaß Wels einen Stadtrichter, dem acht Räte zur Seite standen. Kaiser Ferdinand erhöhte 1568 die Anzahl der Räte auf zwölf. Am katholischen Feiertag des Heiligen Thomas (3. Juli) fand die Neuwahl der Räte und alle zwei bis vier Jahre die Wahl des Stadtrichters aus diesem Kreis statt (seit der Gegenreformation gab es längere Amtsperioden). Alle Mitglieder wurden auf den Landesfürsten und die städtischen Statuten eingeschworen. Danach musste der Stadtrichter nach Wien reisen um sich Acht und Bann, also die volle richterliche Gewalt über Leben und Tod, zu holen. Obwohl die Ausdehnung des Rates eine Verbesserung der städtischen Verwaltung bedeutete, war die Schaffung eines Bürgermeisteramtes nach dem Vorbild von Linz und Steyr Ziel. 1559 gewährte Kaiser Maximilian II. die jährliche Wahl eines Bürgermeisters. Diese Regelung blieb bis 1785 in Geltung.
Die Reise des Stadtrichters fand mit einer Zille (Schiffstyp) auf dem Wasserweg über Traun und Donau statt. Zumeist wurden Edelfische aus der Traun als Ehrengeschenke für Wiener Beamte erworben. Traunfische galten im 16. Jahrhundert als besondere Gaben.
Steyr und seine städtische Verwaltung
Bei Kriegsgefahr oder Ratswahlen kam ursprünglich die gesamte Bürgerschaft Steyrs zusammen. Mit der Zeit wurde ein eigener Rat notwendig, der sich um die Verwaltungsgeschäfte der Stadt kümmern sollte. Dieser alte oder innere Rat bestand aus sechs „Genannten“. Seit 1180 wurde der Stadtrichter vom Landesfürst als sein Vertreter eingesetzt, ab 1287 durfte die Bürgerschaft den Richter direkt ins Amt wählen. Bis 1523 war er vor allem mit Fällen der niederen Gerichtsbarkeit betraut. Seit dem späten 14. Jahrhundert war Steyr aber nicht mehr von der Blutgerichtsbarkeit des Burggrafen abhängig, sondern galt als landesfürstliche Stadt, die nicht mehr dem Burggrafen, sondern dem Landeshauptmann ob der Enns unterstellt war. Seit 1523 durfte auch die Blutgerichtsbarkeit ausgeübt werden. An der Stadtgrenze befand sich der Richtplatz mit dem Galgen, dem Hochgericht und einer Kreuzsäule. 1785 verlor sie alle Privilegien.
Die Gerichtsakten des ehemaligen Stadtgerichtes Steyr sind aus der Zeit von 1494 bis 1778 fast vollständig erhalten und stellen damit eine besondere archivalische Sammlung dar, die umfangreiche Aufschlüsse über die Geschichte der Eisenstadt Steyr vermitteln.
Autorin: Ute Streitt
Schande, Folter, Hinrichtung. Rechtsprechung und Strafvollzug in Oberösterreich. Ausstellung der OÖ. Landesmuseen im Schlossmuseum Linz und Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt vom 8. Juni bis 2. November 2011.